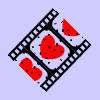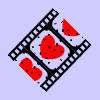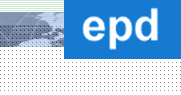|
epd Film (Evangelischer Pressedienst),
Ausgabe Nr. 10/1993, Seite 36 f.
„Ein Herz im Winter”:
{untertitel}
Der Lehrling, der sich von dem Geigenbauer und
Restaurateur Stéphane in seiner Kunst unterweisen läßt,
ist ein andächtiger Schüler. Gleichwohl folgt er nicht
in allem Stéphanes Beispiel: Mit dem Ende des Arbeitstages
gibt der Junge seiner Freundin den Vorzug. Stéphane dagegen
lebt allein, sein Bett steht in der Nähe der Geigen. Auch nach
Feierabend beugt sich der gutaussehende Mitvierziger mit dem verhaltenen
Blick, den Daniel Auteuil bald in einem Lauern erstarren läßt,
bald zur Abwesenheit dämpft, über ihren Körper.
Der Anfang bestärkt darüber hinaus das wortlose Verständnis,
das Stéphane und sein etwa gleichaltriger, doch ungleich
weltgewandter Chef Maxime einander entgegenbringen. Aus den Geschäftsräumen
der Firma, deren altmodische Noblesse und Gastlichkeit Maximes Wesen
zugeordnet sind wie Stéphane das melancholische Dämmerlicht
seiner Werkstatt, kommt Maxime Stéphane zu Hilfe. Während
Stéphane Klangkörper und Resonanzboden der Geige aufeinanderpreßt,
legt Maxime die hölzernen Schraubstöcke an, die das Instrument
(bis) zur Vollendung unter Druck setzen. In diesem vierhändigen
Einsatz, der sich im Handumdrehen als Metapher einer eingespielten
Beziehung zu erkennen gibt, die nur durch Distanz und Aufgabenteilung
funktioniert, nehmen die beiden Männer den Wendepunkt der Geschichte
vorweg. Bislang war es der dritte Körper, das Medium der Musik,
das Medium einer geteilten Berührung, über dem sie zusammenkamen.
Doch die nächste Geige, die Maxime Stéphane zur Reparatur
bringt, verkörpert mehr als ein Instrument, das von schnarrenden
Seiten geheilt werden soll. Die nächste und letzte Geige, die
Stéphane für Maxime zu einer luziden, einer triumphalen,
einer erschreckenden Klarheit umstimmt, gehört der Frau, die
Maxime liebt. Diese Geige ist nichts anderes als die Zuflucht einer
verschlossenen Seele, die in ein Stück Holz gefahren ist.
Der Steg müsse gespannt werden, verkündet Stéphane,
dem die ebenso schöne wie spröde Violinistin Camille Kessler
(Emmanuelle Béart) zur Diagnose aufspielt. Der Steg aber
läßt sich im französischen "l'ame" auch
als Seele verstehen. "Die Seele auf den Punkt bringen",
das ist eine Formulierung, die Sautet, Authentizität und Doppeldeutigkeit
poetisch vermählend, der Sprache der Geigenbauer abgelauscht
hat. So wie Sautet diesen Satz instrumentiert, ihn ins Verhältnis
setzt zu den ersten, sprunghaft und provokant wirkenden Passagen
aus Maurice Ravels "Trio für Klavier, Violine und Violoncello",
die Camille Stéphane während ihrer Proben zu einer Schallplattenaufnahme
vorspielt, bringt sich noch etwas anderes zu Gehör: Bald danach
kommt die mit sich selbst und der Musik ringende junge Frau, die
sich von Maxime liebevoll gefördert, doch nicht herausgefordert
weiß, aus dem Takt, sobald sie sich von Stéphane beobachtet
fühlt. Emmanuelle Béart beherrscht von der gestrengen
Musikerin bis zur zunehmend aller Haltung beraubten Liebenden eine
Gefühlsspanne, die nicht minder bewundernswürdig ist als
die Immitation der musikalischen Technik, die sich die Schauspielerin
für den Film angeeignet hat. Ihr gespieltes Geigenspiel, gelenkt
und gesteigert von den zunehmend wilderen Tempi des Ravelschen Trios,
wird zu vollkommenen Ausdruck der Verwandlung, die Camille durchläuft.Stéphane
umwirbt sie eher beiläufig, doch Camille ist entschlossen,
jede Aufmerksamkeit als Wink der Liebe zu verstehen.
Sautet setzt indessen andere Zeichen. Während der Schallplattenaufnahmen
lehnt Stéphane neben der roten Ampel, die den Moment des
(Sich) Produzierens signalisiert und den Zuschauer zum Schweigen
anhällt. Die Musikerin, die Frau, die in einem isolierten Raum
ihr Äußerstes gibt, der Betrachter hinter den Scheiben,
der unbewegt und stumm auf immer ein Voyeur bleibt -- in diesem
Licht zeigt sich bei Sautet, was Camille irrtümlich für
eine Liebesgeschichte hält.
Eine Frau zwischen zwei Männern, ein Trio im Mittelgrund (mit
einem Cellisten, der zudem in Camille verliebt ist), das wäre
ein annehmbares, doch wenig beunruhigendes Spiel. Sautet befolgt
seine Regeln nur zum Schein, seine Charaktere fügen sich nicht
in das Klischee von untreuen Frauen, falschen Freunden und gehörnten
Liebhabern. Nicht das Bild, das die Protagonisten abgeben und in
Gesellschaft füreinander entwerfen, zählt für Sautet,
sondernd er Rahmen der Geschichte, jenes Geflecht aus (Schutz-)Behauptungen
und Halbwahrheiten, Täuschungen und Selbsttäuschungen,
verkannter und zu spät bekannter Freundschaften, das die Beziehung
zwischen Maxime und Stéphane, aber etwa auch die zu ihrem
ehemaligen Geigenlehrer Lachaume aufrechterhält.
Gemeinsam haben Maxime und Stéphane das Konservatorium besucht,
beide sind sie als Geigenspieler gescheitert. Über die Arbeit
hinaus ist es die Zuneigung zu dem todkranken Lachaume, die zwei
Männer vereint, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Nicht einmal in ihrem Scheitern als Musiker ähneln sie sich.
Der weltgewandte und geistreiche Maxime hat sich bei Lachaume lediglich
als talentierter Laie erwiesen, der verschlossene Stéphane
bringt sich als Kritiker seiner selbst zu Fall. So absolut ist Stéphanes
Gehör, daß er zum Künstler nicht taugt. Die Notwendigkeit
der Selbsterprobung, eine Entwicklung, die jedem künstlerischen
Fortschritt, aber eben auch jeder Menschwerdung vorangeht, beleidigt
sein anspruchsvolles Empfinden. Auch deswegen ist der verstummte
Musiker, den das Ausmaß seiner Ansprüche von der Kunst
und vom Leben fernhält, in diesem Film des ehemaligen Musikkritikers
Sautet ein genialer Restaurateur: Die verdorbene Vollkommenheit
ist Stéphanes Passion, weil er Vollkommenheit nicht erreichen,
wohl aber wiederherstellen kann. "Du wirst Dich freuen",
muntert Maxime, der auf Reisen eine kostbare Geige aufgestöbert
hat, Stéphane einmal auf, "sie ist prächtig, doch
ruiniert."
Es sind die Nuancen, die Anstrengung, den Figuren und ihren Beweggründen
zutiefst gerecht zu werden, die einen Film auszeichnen, der die
Vertracktheit menschlicher (Selbst-)Darstellung und Wahrnehmung
dem Ausspielen einer Geschichte vorzieht. Die Geschichte könnte
Stéphane, der in Anlehnung an ein Experiment des gelangweilten
Dekadents aus Lermontovs Erzählung "Ein Held unserer Zeit"
Camille das Gefühl der Liebe einflößt ohne sie wiederzulieben,
mit der Rolle des Menschenfeindes bedenken. Maxime ließe sich
leicht auf den Part des rasend Eifersüchtigen festlegen. Doch
bei Sautet geht die Geschichte Umwege, weil es ein Ziel, ein Ankommen
für ihre Protagonisten nicht geben kann. Das Zentrum des Films
bleibt leer, die Liebe findet nicht statt. Maximes wissentlicher
Verzicht auf Camille bleibt eine Geste vergeblichen, verzweifelten
Großmuts, weil der Freund, für den er zur Seite tritt,
die Geliebte lächelnd verschmäht. Camilles emotionale
Bankrotterklärung, ihre Geständnisse und Schreie, ihre
Selbsterniedrigung gehen Stéphane schon nichts mehr an. Vollziehen
will er sie nicht, diese Liebe, die er aus Neugierde, vielleicht
aus Eifersucht auf die zur Liebe Befähigten geweckt hat. "Ich
liebe dich nicht", diesen Satz in den Augen der Liebenden wirken
zu sehen, einen Skandal zu entfachen, der nur dem des Todes gleichkommt,
das ist es, was Stéphane davonträgt: Nicht als Sieg,
sondern als Wunde.
Etwas vollkommenes hat er zerschlagen, dennoch werden Zeit und
Vergessen die Zerstörung kaschieren. Maxime und Camille werden
sich wieder zusammentun. Camille wird aus der Begegnung mit Stéphane
ernüchtert und leidgeprüft, und das meint auch, als bessere
Künstlerin, hervorgehen. Nur der Restaurateur weiß sich
nicht zu helfen. Nicht als Dämon, nicht als Immoralist, nicht
mal als Rebell wider die Normalität hat Sautet die Figur des
Stéphane angelegt. Viel eher ist er ein Daueranalysand, ein
Theatergänger inmitten der Realität, dem die Unfähigkeit
aus der Rolle des ewigen Zuschauers auszubrechen, letztlich durch
und durch geht. Für einen einzigen Dienst läßt sich
dieses "Herz im Winter" erwärmen, das ist der Tod,
den nur Stéphane dem siechen Lachaume zu geben vermag. Wenig
später wird der Mann, der dem einzigen Menschen, den zu lieben
er sich jemals eingestehen konnte, wortlos eine tödliche Injektion
gegeben hat, wieder in seinem Stammcafé sitzen. Maxime und
Camille werden auftauchen wie früher, zum Abschied werden Küsse
vergeben, Blicke verschenkt.
Für den Blick, mit dem Stéphane zurückbleibt,
für die Aussicht auf das Leben, das hinter den Bistroscheiben
an ihm vorbeizieht, gibt es den Austausch nicht mehr, nicht den
Blick, den man wechselt. Der Held unserer Zeit bleibt auf seinen
Einsichten sitzen, sei es im Café, sei es im Kino.
von Heike Kühn
|
|