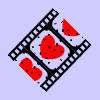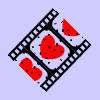|
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
7. Oktober 1993:
Sie springt, er denkt
Fast nichts, also Kunst – „Ein Herz im Winter”, der neue Film von Claude Sautet
Eine junge, sehr hübsche aufstrebende Geigerin verliebt sich
in einen Geigenbauer, und zwar in Paris. O je! Das klingt schon
wieder nach Beziehungskiste und prätentiöser Langeweile,
überhaupt nach jener „Filmkunst”, die in Europa gerade so dramatisch
verfällt. Und der Film ist auch kein bißchen üppig
und universal, dröhnend und panisch um die Übertrumpfung
seiner selbst bekümmert wie das Hollywoodkino heutiger Machart,
das uns der „Spiegel” als Alternative entgegenhält und tapfer
gegen den europäischen Protektionismus verteidigt.
„Ein Herz im Winter” von Claude Sautet ist anders — ganz anders,
versteht sich, als die Filme, in denen nur die Saurier noch natürlich
wirken, die Schauspieler hingegen wie künstlich animierte Sprechpuppen,
anders aber auch als all die Kunstfilme, in denen die Kunst ans
Kunstwollen nicht mehr heranreicht, zumal wenn sie von einem ohnehin
immer seltener gewordenen Thema wie der Liebe handeln. Worin besteht
die Differenz?
Sie ist leicht zu erklären, doch schwer zu beschreiben: Sie
ergibt sich aus der Konzentration der Schauspieler auf ihre Rollen
und der des Regisseurs auf die Schauspieler. Manchmal fällt
auch dieser Film hinter sie zurück, etwa wenn Emmanuelle Béart
das Geigenspiel mimt — der Anblick scheinmusizierender Schauspieler
ist immer etwas peinlich. Die Musik allerdings, Ravels Violin- und
Triosonaten mit ihren unbegreiflich organischen Übergängen
von rauhesten Staccati in elegantes Schmachten, ist hinreißend.
Zum Tragen kommt die Differenz, von der hier die Rede ist, vor
allem in den Dialogszenen zwischen Emmanuelle Béart als Camille
und Daniel Auteuil als Stéphane, die zumeist in der Öffentlichkeit
stattfinden, in Cafés oder gar unter den Augen des Dritten
im Dreieck. Erst durch Maxime (André Dussolier), den Compagnon
Stéphanes und Geliebten Camilles nämlich, haben sie
sich überhaupt kennengelernt. Die erotische Anziehung ist sofort
spürbar, doch kaum dingfest zu machen.
Es ist ein Theater aus verstohlenen Blicken, zusammengekniffenen
Lippen, winzigen Verlegenheitsgesten und Gesprächspausen, die
eine halbe Sekunde zu lang dauern. Béarts und Auteuils Spiel
ist Welten entfernt von der muskulösen Schauspielmethode Hollywoods,
in der noch Lidschläge anmuten, als wären sie an Gewichten
trainiert. Béart und Auteuil sind Minimalisten, sie gehen
an die Grenze des Wahrnehmbaren. So lassen sie den Zuschauern Raum
für Projektionen. Errötet sie tatsächlich, als er
sie, ausnahmsweise mal, unverwandt ansieht?
Claude Sautet erzählt nicht, wie etwas geschieht, sondern
wie etwas nicht geschieht. Stéphane verpaßt die Chance
auf Camilles Liebe. Diese Katastrophe begeht der Film in aller Stille.
„Ich begehre Sie”, sagt Camille, mit aufgeregtem, weit offenem Blick.
Dies erinnert an eine Stelle in Sartres „Ekel”: Man müsse „eine
Verblendung haben”, um jemanden zu lieben, heißt es da, „es
gibt sogar einen Moment, ganz am Anfang, wo man über einen
Abgrund springen muß: wenn man nachdenkt, tut man es nicht.”
Camille springt, Stéphane denkt nach. „Ich liebe Sie nicht”,
sagt er dann und lügt dabei.
Ihr Blick erlischt, seiner bleibt undurchdringlich — fast nichts
ist den beiden anzusehen. „Fast nichts” – presque rien – hieß
eine Kategorie der klassischen französischen Theaterästhetik.
So wurde die unbenennbare Nuance umschrieben, die Kunst von Prätention
abhebt. Die Zuschauer müssen empfindlich genug sein, solche
Nuancen zu registrieren, um die Abgründe der Leidenschaft unter
der stillen Oberfläche zu ermessen. Im deutschen Publikum wird
„Ein Herz im Winter” daher wohl nur wenige Freunde finden.
von Thierry Chervel
|
|