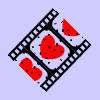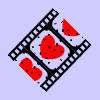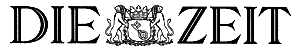|
Die Zeit, Nr. 3/1996 vom 12. Januar 1996, Seite 54, Feuilleton/Kino
Ein Alltagsparadies
Claude Sautets Film „Nelly & Monsieur Arnaud”
Ein älterer Mann und eine junge Frau: Gespräche, Erzählungen,
knappe Blicke, scheue Gesten. Mehr nicht: ein Film nahezu ohne
Geschichte; eine Vision aus Fragment und Skizze. Ein Kino wie
das Leben selbst, das nicht mehr die Menschen beschreibt, sondern
„das Leben allein, das, was zwischen den Menschen ist, den Raum,
den Ton, die Farben.” Die alte Utopie von Godards „Pierrot le
Fou”, die später bei Wenders wieder auftauchte, im „Stand der
Dinge”.
Die junge Frau, ständig in Geld- und Jobnot, ist gerade dabei,
sich von ihrem Mann zu trennen. Der ältere Mann ist dabei, die
letzte Summe zu ziehen; er schreibt an seinen Memoiren, über
die Zeit als Richter in den französischen Kolonien. Eines Tages
begegnen sie sich über eine gemeinsame Freundin, und er erfährt
dabei von ihren Schwierigkeiten.
Spontan bietet er ihr die Mitarbeit an seinen Erinnerungen an.
Aus dieser zufälligen Begegnung entsteht vertrautes Empfinden,
aus dem wiederum zaghafte Zuneigung sich bildet. Die Frau fühlt
sich sicherer und sieht sich neu um; der Mann reagiert irritiert
und schaut, erstmals seit langem, nach innen.
Eine Situation, die – um nur bei Sautets näheren Kollegen zu
bleiben – üblicherweise benutzt wurde für Größeres und Gröberes.
Bei Autant-Lara wäre sie zum Melodram entwickelt, bei Clement
zur übergroßen Tragödie entworfen, bei Lelouch zur Schnulze
verkommen.
Sautet macht daraus einfach einen visuellen pas de deux. Michel
Serrault, der Komödienkaspar, und Emmanuelle Béart, la
belle noiseuse: Beide spielen gegen ihr Image und entzücken gerade
durch ihre ungewohnte Schlichtheit. Ihre Zuneigung ist, im Sinne
von Oscar Wilde: „frei wie die Flucht, wild wie der Wind!”
Um die beiden herum: ihre ehemaligen Partner, ein paar Freunde,
der dynamische Verleger, der nicht nur auf die Memoiren des älteren
Mannes aus ist. Und Michael Lonsdale taucht mehrmals auf, angeblich,
um Geld einzutreiben. Sautet inszeniert ihn als MacGuffin, als
nebensächliches Detail, das irgendwann die Fragen im Zentrum
bündelt: Wer? Und wie? Und wieso? Lonsdale ist zudem der einzige,
der den männlichen Blick auf die schöne Emanuelle wagt, voll
insgeheimer Wollust: der Stellvertreter für uns männliche Zuschauer
auf der Leinwand.
Ausgangspunkt für diesen Film, sagt Sautet, sei ein Bild gewesen,
das ihm seit seiner Jugend vor Augen stehe: das eines älteren
Mannes, der im Cafe neben einer jüngeren Frau sitze, bei Kaffee
und Cognac, beide vertieft in intensive Unterhaltung. Ein Bild
— jenseits von familiärer Idylle oder offener Prostitution. Ein
Bild, das Fragen stellt, ohne Antworten zu geben. Und genau so
legt Sautet auch seinen Film an: „Nelly & Monsieur Arnaud”
erzählt nicht, er gibt einer Situation Kontur, die an den Dogmen
des Üblichen kratzt. Er zeigt ganz offen die Schwächen seiner
Helden, ohne sie doch bloßzustellen; was wiederum ihre Stärken
hervorhebt, ihre Phantasie und ihre Kraft.
Nur einmal ein Streit; der dann aber so heftig, daß sich die
Fronten klären. Er nörgelt herum, schreit und schimpft, wirft
ihr vor, nicht mehr bei der Sache zu sein. Sie, sichtlich getroffen,
wartet einen Moment, dann entscheidet sie, einfach zu gehen. Was
seine Wut zum Äußersten treibt. „Du solltest wieder einmal richtig
ficken!” Sie bleibt abrupt stehen und verharrt, die Kamera blickt
dabei starr auf ihren Rücken; dann geht sie weiter zur Tuer,
dreht sich kurz um und lächelt: „Morgen geht's leider nicht.
Aber am Mittwoch. Bis Mittwoch?” Sie sieht sein Begehren hinter
der Beleidigung, seine Eifersucht hinter der Eiferei. Das macht
sie ruhig und freundlich.
Die entsprechende Szene, in Umkehrung, kurz danach. Sie, völlig
niedergeschlagen, sucht Ruhe und Verstaendnis bei ihm. Sie reden
und trinken, schließlich bleibt sie über Nacht. Er ist berauscht
von ihr, verliebt und fasziniert. Während sie schläft, schleicht
er zu ihr, schaut sie voller Entzücken an. Als sie plötzlich
erwacht, will er sich schnell davonstehlen. Doch sie lächelt
ihn nur an, ergreift seine Hand und schläft weiter. Nach dieser
Szene ist alles klar, ohne daß ein einziges Wort darüber verloren
würde: Die Würfel sind gefallen.
Je älter Claude Sautet wird, desto ruhiger und schlichter werden
seine Filme. Keine großen Tragödien mehr, wie noch in „Einige
Tage mit mir” und „Ein Herz im Winter”; auch keine melancholischen
Burlesken wie in den sechziger und siebziger Jahren um Romy, Yves
und Michel. Nur noch Visionen um ein Bild, über das andere Bilder
entstehen.
Sautets neue Ausdrucksweise, sie ist, wie beim alten Velasquez
(nach Elie Faure), ein Spiel mit Zwischentönen: „Alle Dinge,
die er filmt, umgibt er mit Luft und Dämmerung; überraschend
die Schatten und die Transparenz der Hintergründe; die farbigen
Reflexe, die er zum unsichtbaren Mittelpunkt seiner Kompositionen
macht. Er erfaßt in der Welt nur noch die geheimnisvollen Veränderungen;
Veränderungen, die Formen und Töne einander durchdringen lassen
— in einem unaufhörlichen Fließen, bei dem kein Stoß, kein
Ruck die Bewegung stört oder unterbricht. Der Raum allein regiert…”.
Vom ersten Film an war Sautet ein Melancholiker. Sein Blick
auf die Welt ist heiter, dabei aber wehmütig und schwarz: Gelegentlich
(wie etwa in „Kollege kommt gleich”) wollte er das durch Humor
kaschieren. Aber dann hielten seine Bilder nicht mehr, was seine
Zuschauer sich von ihnen erhofften. Nun, mit seinem neuen Film,
erweist sich Sautet zudem als Mystiker. Er versenkt sich in alles,
was seine Protagonisten umgibt: Straßen, Häuser und Cafès, Möbel,
Bücher und Gemälde. In allem findet er einen Widerhall seiner
„Geschichte”. Auf eine gewisse Weise filmt er, als suche er stets
das letzte, endgültige Bild zu entwerfen. Er beschwört das Paradies
— und findet darüber die Alltagsdinge des Lebens.
von Norbert Grob
|
|