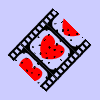Für die Filmmusik hat Claude Sautet eine Aufnahme des Trios und der Sonaten von Maurice Ravel ausgewählt, die im Januar und im Dezember 1973 in Paris (Église Notre-Dame du Liban) in folgender Besetzung aufgezeichnet wurde:
- Jean-Jacques Kantorow (Violine)
- Philippe Muller (Cello)
- Jaques Rouvier (Klavier Steinway)
- Aufnahmeleitung: Michel Garcin
- Tonmeister: Pierre Lavoix
- Schnitt: Françoise Garcin und Pierre Lavoix
Im Bild Claude Sautet im Kreise der Film-Musiker während der Dreharbeiten:
Die einzelnen Titel des Soundtracks:
Trio für Klavier, Violine und Cello
- Premier mouvement
- Pantoum
- Passacaille
- Final
Sonate für Violine und Cello
- Allegro
- Très vif
- Lent
- Vif, avec entrain
Sonate für Violine und Klavier
- Premier mouvement
- Blues
- Perpetuum mobile
Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré (für Violine und Klavier)
Musik von: Maurice Ravel (1875–1937)
Musikredaktion: Philippe Sarde
Music from the Movies: Philippe Sarde
Der Soundtrack von Erato Disques S. A. (1973, 1974) können Sie auch kaufen (Amazon.de).
Das CD-Cover:
Regisseur Claude Sautet erzählt über die Auswahl der Musik zu seinem Film:
Der Film „Un cœur en hiver” spielt während der Proben und Aufnahmen zu einer Schallplatte mit klassischer Musik.
Nachdem auf wenigen Seiten knapp umrissen das Szenario und die Beziehungen der Hauptpersonen untereinander, zwei Lautenisten und eine Violinistin, vorlagen, stellte sich die Frage nach der Musik, also nach dem musikalischen Untergrund, der die Atmosphäre der Handlung bedingen würde.
Da erinnerte ich mich an eine Interpretation des Trios und zweier Sonaten von Ravel durch Jean-Jacques Kantorow… und sogleich wurde mir bewußt, das ist es und nichts anderes.
Der Anfang des Trios bestimmt das Klima des Films: eine tiefe, doch zarte, zurückhaltende Melancholie. Die beiden Sonaten mit ihren funkelnden, gleichsam diabolischen Rhythmen, besonders der „Blues” und das „Perpetuum mobile”, gaben mir die Untermalung für die Arbeit der Geigerin und die psychologische Entwicklung der Gestalt.
Ich hörte mir alle zur Verfügung stehenden Schallplatten an; doch keine erreichte die Strenge, den Gefühlsgehalt und die Kraftfülle, die aus der Einspielung von Jean-Jacques Kantorow sprechen. Für den Vorspann mußte Philippe Sarde den ersten Satz des Trios so getreu wie möglich im Geiste Ravels kürzen, oder sagen wir „kondensieren”.
Zweifellos spiegelt der Film auch die Faszination wieder, die dieser rätselhafte Musiker seit langem auf mich ausübt, dieser ebenso kokette wie peinlich sorgfältige Komponist, der ein einsames Leben führte und Automaten sammelte, und dessen verborgene Empfindungen sich in einer Musik niedergeschlagen haben, die ganz Charme und Anmut ist.
(übersetzt von Gerhard Trautmann)
Jean Gallois über das Trio und die Sonaten von Maurice Ravel:
„Ich würde gerne die ganze Kunst, von der das Trio zeugt, gegen das angeborene Können austauschen, das aus dem Quartett spricht.” Muß diese Roland-Manuel gegenüber gemachte Bemerkung wörtlich genommen werden?
Zu dem altbekannten Problem des Gleichgewichts zwischen Hammer- und Zupfsaiteninstrumenten und zu der eingestandenen, aber doch überholten Erinnerung an Saint-Saëns, kommt bei dem Klassiker Ravel der Bezug auf traditionelle Gesetzmässigkeiten hinzu: das „Trio” wird von einem Satz in Sonatenform eingeleitet, während der dritte eine Passacaglia ist. Was aber wäre diese „Kunst”, wenn nicht das magische, überwältigende „Könnnen” hinzukäme, das die ganze Partitur belebt?
Bevor er 1914 an die Komposition geht, hat Ravel den zweifachen Schock von Strawinski mit dem „Sacre du Printemps” und Schönberg mit dem „Pierrot lunaire” erlebt. Sein eigenes Genie wird davon bereichert. Mehr denn je trachtet er danach, mit den Klangfarben zu spielen, jedoch nunmehr weniger durch Verschmelzung, als durch Häufung und Schichtung. Seine kreative Begeisterung kennt keine Grenzen. Daher wohl die Linienführung der Melodie und die wunderbar subtile Rhythmik, durch welche die Klangfarben erst richtig zur Geltung gebracht werden.
Das erste Thema des einleitenden „Modéré” ist fast indifferent und doch gleichsam lustvoll verhalten zu nennen, während das zweite sich anheimelnd einer naiven Zärtlichkeit hingibt. Der sich sehr frei an die malaisische Folklore anlehnende Satz „Pantoum” vereint mit großer metrischer Vielfalt den klanglichen Schwung eines brillant beherrschten Scherzos. Die „Passacaille”, eines der schönsten Themen von Ravel, ist ein wundervoll poetisches Notturno, während das glänzende, verhalten ausdrucksvolle Finale mit seinen abwechselnden 5/4- und 7/4‑Takten das Werk in einem großartigen klanglichen Feuerwerk zum Abschluß bringt. Handwerk und Intuition, „Kunst und Können”, sind miteinander ausgesöhnt, sublimieren sich wechselseitig.
Eine ganz andere, weit vom „Trio” entfernte Stimmung beherrscht das von April 1920 bis Februar 1922 komponierte „Duo für Violine und Cello”, zweifellos das herbste, gespannteste und wohl auch diskordanteste von Ravels Werken. Viel hat sich in der Tat in der Welt verändert. Der Weltkrieg hat Gedanken und Gefühle der Menschen hochgradig aufgereizt; hinzu kommen schmerzliche persönliche Erfahrungen wie Krankheit und der Tod der Mutter, aber auch neue ästhetische Erkenntnisse wie der Jazz und die Negerkunst. Der Komponist verzichtet ausdrücklich auf liebliche Harmonien und Melodien, indem er sich in seinem Denken wie in seinem Kompositionsstil dem neuen Anspruch auf extreme Sachlichkeit unterwirft. So entsteht ein schwieriges, ja fast gewalttätiges Werk. Aus dem ersten Thema entwickeln sich fast alle folgenden, und alle Motive erscheinen wieder in dem kraftvoll polyphonen Abschluß. Die Komplexität der zyklischen Form läßt aus den Kontrasten und Brüchen im Widerspiel der beiden Solisten im ersten „Allegro”, wie aus der Agressivität des Satzes „Très vif”, die kaum durch die verhaltene Emotion des dritten Satzes oder die kunstvoll rhythmisierten Motive des grandiosen „Finales” zurückgedrängt wird, so etwas wie Unbehagen, wenn nicht innere Unruhe entstehen. Nie zuvor hat Ravel eine so herbe, raue Musik geschrieben, auch später nicht.
Neben diesem Meisterwerk erscheint die im September 1922 entstandene „Berceuse” eher wie ein liebenswürdiges Divertimento. Liegt aber dahinter nicht die Absicht, wieder zu der Transparenz, zu der von Fauré abgeschauten Einfalt zurückzufinden, auf dessen Namen das Stück komponiert ist? Hier hat die Musik andere Dimensionen, andere Anliegen, nämlich die Dankbarkeit seinem ehemaligen Lehrer gegenüber und die freundschaftliche Verehrung für den Meister, der mit siebzig Jahren gerade sein bewundernswertes Quintett für Klavier und Streicher C‑moll op. 115 vollendet hat.
Als sei er sich bewußt geworden, mit dem „Duo” zu weit und mit der „Berceuse” nicht weit genug gegangen zu sein, scheint Ravel mit der 1923 bis 1927 entstandenen „Sonate für Klavier und Violine” seine eigene, diskretere, klassischere Stimme wiedergefunden zu haben. Ist er weise geworden? Legt er eine Besinnungspause ein? Wahrscheinlich beides, und eine Wette mit sich selbst, insofern als er nicht nochmals den gleichen Weg gehen will. Vielleicht beschäftigt ihn auch die Nachfolge von Debussy mit seinen drei Sonaten aus dem Jahr 1918. Das Werk ist gefälliger als das „Duo”, trotz seiner Gradlinigkeit und seiner aufgelockerten Harmonik. Das erste „Allegretto” beginnt mit langen 6/8- und 9/8‑Rhythmen und weist nicht weniger als fünf Motive auf. Der zweite Satz, „Blues”, irritierte mit seinem doppelten Anliegen: er sollte das gutbürgerliche Publikum schockieren und dem Jazz Eingang in die ernste Musik verschaffen. Daher nach dieser vorübergehenden Erschlaffung das strenge „Perpetuum mobile”, wie eine flüchtige Sternschnuppe… und im Hintergrund das sarkastische Lächeln von Meister Paganini. Gewissermaßen die Aussöhnung der Klassik mit der Moderne.
(übersetzt von Gerhard Trautmann)