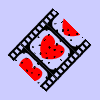Stellvertretend hier die zwei sehr gelungenen Kriktiken aus SZ und FAZ. Viele weitere Kritiken finden Sie auf der archivierten Version dieser Website, die von 1999 bis 2020 online war (siehe unten).
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Oktober 1993:
Sie springt, er denkt
Fast nichts, also Kunst – „Ein Herz im Winter”, der neue Film von Claude Sautet
Eine junge, sehr hübsche aufstrebende Geigerin verliebt sich in einen Geigenbauer, und zwar in Paris. O je! Das klingt schon wieder nach Beziehungskiste und prätentiöser Langeweile, überhaupt nach jener „Filmkunst”, die in Europa gerade so dramatisch verfällt. Und der Film ist auch kein bißchen üppig und universal, dröhnend und panisch um die Übertrumpfung seiner selbst bekümmert wie das Hollywoodkino heutiger Machart, das uns der „Spiegel” als Alternative entgegenhält und tapfer gegen den europäischen Protektionismus verteidigt.
„Ein Herz im Winter” von Claude Sautet ist anders — ganz anders, versteht sich, als die Filme, in denen nur die Saurier noch natürlich wirken, die Schauspieler hingegen wie künstlich animierte Sprechpuppen, anders aber auch als all die Kunstfilme, in denen die Kunst ans Kunstwollen nicht mehr heranreicht, zumal wenn sie von einem ohnehin immer seltener gewordenen Thema wie der Liebe handeln. Worin besteht die Differenz?
Sie ist leicht zu erklären, doch schwer zu beschreiben: Sie ergibt sich aus der Konzentration der Schauspieler auf ihre Rollen und der des Regisseurs auf die Schauspieler. Manchmal fällt auch dieser Film hinter sie zurück, etwa wenn Emmanuelle Béart das Geigenspiel mimt — der Anblick scheinmusizierender Schauspieler ist immer etwas peinlich. Die Musik allerdings, Ravels Violin- und Triosonaten mit ihren unbegreiflich organischen Übergängen von rauhesten Staccati in elegantes Schmachten, ist hinreißend.
Zum Tragen kommt die Differenz, von der hier die Rede ist, vor allem in den Dialogszenen zwischen Emmanuelle Béart als Camille und Daniel Auteuil als Stéphane, die zumeist in der Öffentlichkeit stattfinden, in Cafés oder gar unter den Augen des Dritten im Dreieck. Erst durch Maxime (André Dussolier), den Compagnon Stéphanes und Geliebten Camilles nämlich, haben sie sich überhaupt kennengelernt. Die erotische Anziehung ist sofort spürbar, doch kaum dingfest zu machen.
Es ist ein Theater aus verstohlenen Blicken, zusammengekniffenen Lippen, winzigen Verlegenheitsgesten und Gesprächspausen, die eine halbe Sekunde zu lang dauern. Béarts und Auteuils Spiel ist Welten entfernt von der muskulösen Schauspielmethode Hollywoods, in der noch Lidschläge anmuten, als wären sie an Gewichten trainiert. Béart und Auteuil sind Minimalisten, sie gehen an die Grenze des Wahrnehmbaren. So lassen sie den Zuschauern Raum für Projektionen. Errötet sie tatsächlich, als er sie, ausnahmsweise mal, unverwandt ansieht?
Claude Sautet erzählt nicht, wie etwas geschieht, sondern wie etwas nicht geschieht. Stéphane verpaßt die Chance auf Camilles Liebe. Diese Katastrophe begeht der Film in aller Stille. „Ich begehre Sie”, sagt Camille, mit aufgeregtem, weit offenem Blick. Dies erinnert an eine Stelle in Sartres „Ekel”: Man müsse „eine Verblendung haben”, um jemanden zu lieben, heißt es da, „es gibt sogar einen Moment, ganz am Anfang, wo man über einen Abgrund springen muß: wenn man nachdenkt, tut man es nicht.” Camille springt, Stéphane denkt nach. „Ich liebe Sie nicht”, sagt er dann und lügt dabei.
Ihr Blick erlischt, seiner bleibt undurchdringlich — fast nichts ist den beiden anzusehen. „Fast nichts” – presque rien – hieß eine Kategorie der klassischen französischen Theaterästhetik. So wurde die unbenennbare Nuance umschrieben, die Kunst von Prätention abhebt. Die Zuschauer müssen empfindlich genug sein, solche Nuancen zu registrieren, um die Abgründe der Leidenschaft unter der stillen Oberfläche zu ermessen. Im deutschen Publikum wird „Ein Herz im Winter” daher wohl nur wenige Freunde finden.
von Thierry Chervel
Süddeutsche Zeitung, Nr. 232/1993 vom 7. Oktober 1993, Seite f16:
Ich liebe Sie nicht.
Claude Sautets großartiger Film „Ein Herz im Winter”
Ein eisiges Herz schlägt auf dem Grund dieses Films und treibt die Geschichte gnadenlos ihrem Ende zu. Der dumpfe Schlag stammt von Lermontows Novelle, die beim Drehbuch Pate stand. Darin geht es um einen Mann, der eine Frau zur Liebe verführt, nur um ihr dann sagen zu können: Ich liebe Sie nicht! Von dieser Anekdote ist am Ende nichts als die Abfuhr übrig geblieben, aber man kann ihre Grundzüge noch schemenhaft erkennen. Wie einen bleichen Fisch unter dem Eis eines zugefrorenen Sees.
Der Titel „Ein Herz im Winter” sagt schon alles über den Helden. Seine Gefühle sind eingefroren, sein Herz ist vereist. Man sieht es ihm nicht gleich an, denn die Schweigsamkeit und Bedachtheit sind Teil seines Berufs. Stéphane (Daniel Auteuil) ist Geigenbauer und gibt sich seiner Arbeit mit jener Versunkenheit hin, die dieses in die Stille gerichtete Handwerk erfordert. Da ergänzt er sich ideal mit seinem Freund und Partner Maxime (André Dussollier), der im Umgang mit den Musikern jenes Geschick besitzt, das Stéphane im Umgang mit seinen Instrumenten auszeichnet. Die beiden haben sich in ihrer Liebe zur Musik gefunden.
Schon der Anfang beweist Sautets Meisterschaft. Da legt sich Stéphanes Stimme über einen kurzen Bilderbogen aus dem Leben der beiden Freunde. Man sieht sie, wie sie Musikern beim Vorspiel mit verstimmtem Instrument zuhören, wie sie in der Werkstatt gemeinsam Hand anlegen, wie sie beim Konzert applaudieren, wie sie Squash spielen und im Restaurant sitzen. Danach weiß man alles über ihre Hingabe, ihr Verständnis, ihr Verhältnis. Maxime nimmt das Leben und die Liebe auf die leichte Schulter, Stéphane sieht ihm dabei neidlos zu. Der eine macht aus dem Leben eine Kunst, der andere aus der Kunst ein Leben.
Da kommt die Geigerin Camille (Emmanuelle Béart) ins Spiel, und diesmal ist es Maxime zur Abwechslung ernst. Er zeigt sie seinem Freund in einem Restaurant, wo sie ein paar Tische entfernt sitzt. Später bringt er sie mit in die Werkstatt, wo sie Stéphane ihr verstimmtes Instrument vorführt. Er hört ruhig zu, dann macht er sich ans Werk. Zu Camille äußert er sich Maxime gegenüber nicht weiter. Er sieht zu und wartet ab. Er kennt seinen Freund. Aber schon bald wird klar, daß Camille Stéphanes ruhige Art als aufreizend empfindet. Bei einem Hauskonzert kommt sie unter seinem ungerührten Blick mehrfach aus dem Takt. Die beiden, würde man sagen, finden einander nicht sonderlich sympathisch. Aber sie haben eben in Maxime einen gemeinsamen Freund.
Eine Choreographie aus Gesten und Blicken entwirft Claude Sautet in diesem Film, in der sich Ungesagtes und Unmerkliches zur wahren Geschichte des Films aufschwingen. Im kühlen Arrangement der Bilder werden die Spannungen, die sich zwischen den dreien aufbauen, nach und nach greifbar. Und die Regie unternimmt alles, ihnen keine Möglichkeit zum Entweichen zu bieten. Es gibt keine klärenden Worte, keine eindeutigen Absichten. Es gibt nur die Emotionen, die sich schleichend ausbreiten. Man könnte es auch Liebe nennen.
Camille verliebt sich in Stéphane. Aber der verleugnet seine Gefühle. Vielleicht hat er Angst; vielleicht ist er dazu einfach nicht fähig. Atemlos folgt man dem grausamen Spiel und fragt sich mit Camille, wie es möglich war, daß man sich so täuschen konnte: „Als Sie mich besuchten, im Studio, als es regnete. Das habe ich doch nicht geträumt.” In der Tat war das eine wunderbare Szene. Alles schien möglich. Wie im Traum.
Die grandiose Kamera von Yves Angelo organisiert die Räume so, daß die Oberflächen so transparent wie möglich wirken. In jener Szene im Tonstudio etwa geht Stéphanes Blick durch eine Glasscheibe, worin sich gleichzeitig ganz gut sein Verhältnis zur Welt spiegelt. So wird immer wieder die Distanz spürbar, die der Held zwischen sich und seine Umgebung gelegt hat.
Stéphane, der in seiner Freizeit Spieluhren repariert, erwartet auch vom Leben reibungsloses Funktionieren. Die Emotionen erscheinen ihm wie Sand im Getriebe der selbst auferlegten Perfektion. Den reinen Klang, den er von den Gefühlen erwartet, findet er nur in der Musik. So hat er alle Leidenschaft in seinen Instrumenten begraben. Als ginge ihm selbst der Resonanzboden für seine Gefühle ab.
Gerade durch die Verleugnung scheinen sich die Gefühle besonders deutlich abzuzeichnen. Der Film pulsiert vor innerer Spannung, und der äußere Ablauf paßt sich dem an. Die Geschichte scheint in ihrem Fortgang zu changieren wie die Stimmungen. Bis zum Ende. Das ist ein Anfang. Frühling, Schneeschmelze, und die ersten Triebe brechen durchs Eis.
(in München im Filmcasino, Odyssee, Rex, Isabellla, Cinema)
von Michael Althen
Archivierte Version
Hier geht es zur archivierten Version dieser Website. Die alte Fassung war von 1999 bis 2020 online. Sie enthält insbesondere zahlreiche weitere Kritiken zu “Ein Herz im Winter”.