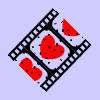|
Frankfurter Rundschau, 5. September 1992, Seite 8
Pistolen & Geigen
Erste Wettbewerbsfilme
von Rockwell, Sembene, Sautet und eine rumänische Parabel
VENEDIG. Während der mäßig besuchten
Eröffnungsgala auf dem Lido war im Büro, drüben in Venedig, die
Finanzpolizei tätig. Sie forschte nach Unterlagen über mögliche
finanzielle Schiebungen zu Beginn der 80er Jahre, als eine private
Firma die Gäste des Festivals betreute und dabei (wie üblich?) Steuern
in der Höhe von 450 Mio. Lire unterschlagen haben soll. Wo im vergangenen
Jahr noch die Pressefächer der Journalisten waren in einem ebenerdig
gelegenen großen Saal des Casinos, das einzig der Akzent als
Spielcasino vom Tummelplatz sexueller Spiele unterscheidet: dort
ist jetzt die Halle mit ununterbrochen rasselnden „einarmigen
Banditen” bestückt, die viel Zulauf haben. Klein Las Vegas
auf dem Lido als Rettungsaktion des einstigen Erholungsparadieses
des internationalen Großbürgertums? Es rasselt und blitzt an dem
Ort; aber die Geräusche der Spielautomaten werden ihn auch nicht
mehr aus einem Schlaf erwecken, der schon lange währt. Hier hat
man die eigene Zukunft verschnarcht. In den „Schützengräben”,
die der Festivalleiter Pontevorco aufgeworfen haben will, sitzt
eine bislang enttäuschte Mannschaft. Wäre nicht der morgendliche
Besuch in der „Zweiten Heimat” (die wirklich eine für
Cineasten ist): das bisherige Aufgebot des Wettbewerbs könnte einen
schon jetzt skeptisch stimmen für den Angriffsgeist der diesjährigen
Mostra.
Der 1956 geborene US-Amerikaner Alexandre Rockwell – manche
mögen seine früheren Spielfilme „Lenz” (nach Buechner),
„Heros” (mit David Bowie und den Rolling Stones) oder
„Sons” gesehen haben – gehört zur Off-Hollywood-Scene wie
Michael Aptet, Susan Seidelman oder Jim Jarmusch, der in Rockwells
neuestem Film „In the soup” einen Produzenten spielt.
In die Suppe gefallen ist der New Yorker Jungfilmer Adolpho, als
er auf den Gangster Joe trifft. Denn Joe, den als ebenso brillant
und warmherzig wie raffiniert-hochstaplerisch der schnauzbärtige
Symour Cassel spielt, ist auf die Zeitungsanzeige angesprungen,
mit der Adolpho sein 500(!)seitiges Filmskript zum Kauf angeboten
hatte. Der Autorenfilmer, der seine cineastische Jungfernzeugung,
die ihm Dostojewski und Nietzsche eingegeben hatten, verhökert,
braucht dringend das Geld für die Miete. Zwei brutale zugleich
aber sangesfreudige Mafiosi wollen die ausstehende Miete eintreiben.
Aber Adolpho kann die 700 Dollar für sein Skript behalten, weil
Joe, der ihn besucht hatte, mit den Kleingangstern wie ein Pate
umgeht, der ihren Boss kennt. Freilich verwickelt der väterliche
Freund den jungen Naivling in kriminelle Aktivitäten: so klauen
sie einen Porsche, der einem Polizisten(!) gehört, plündern eine
Wohnung aus und bereiten einen größeren Coup vor. Immer tiefer
in die trübe Suppe, die Joe anrührt, gerät der Möchtegern-Regisseur,
nachdem Joe die Regie seines Lebens uebernommen hat. Sogar die abweisende
Nachbarin, die Adolpho insgeheim für die Hauptrolle seines Monumentalwerks
vorgesehen hatte, kommt ihm näher ja: zu nahe. Denn nach und nach
bemerkt er, daß sie Teil eines Komplotts ist, das zuletzt Joe das
Leben kosten wird. Er hatte die Kreise größerer Banditen gestört;
aber sterbend verlangt er Adolpho ab, seine Hirngespinste aufzugeben
und eine Love-Story zu verfilmen, die aus dem Leben gegriffen ist.
Rockwell inszeniert mit leichter Hand, spielerisch, mit Witz und
guter Laune eine Tragikomödie zwischen „Atlantik City”
und „La vie de Boheme”. Eine augenzwinkernde Hommage an ein
lässig-selbstverliebtes Unterhaltungskino; einen postmodernen Jux
wollte er sich da machen, und der ist ihm (etwa anämisch und flapsig)
zwischen Jarmusch und spätem Kaurismaeki ganz gut gelungen.
Der
1924 geborene Claude Sautet gehört zu den Altmeistern eines „cinema
de qualite” des derzeitigen französischen Films. Ein guter,
eleganter metteur-en-scene in der zweiten Reihe, bekannt bei uns
u. a. mit „Cesar und Rosalie” oder „Vincent, Francois,
Paul und die anderen”. Der Zufall will es auf der Mostra, daß
einem die Musik, die in Edgar Reitz' „Zweiter Heimat” wie keine andere Kunst dominiert, auch bei Sautets „Herz im
Winter” wieder ausführlich begegnet ebenso die klassische
Dreiecks-Situation von „Jules und Jim”, nach der in den
60igern weniger vom Blatt des Romans als nach der Leinwand „geliebt”
wurde, auf die Truffauts zärtliches Schattenspiel mit Jeanne Moreau
und Oskar Werner fiel. Auch bei Sautet ist es die Frau, die stärkere,
wildere, verletzlichere Gefühle zeigt als die beiden Männer, die
sie an sich zieht. Eine Violinvirtuosin – die „schöne Querulantin”
mit dem Porzellangesicht: Emmanuelle Béart – beginnt eine Liaison
mit Maxime (André Dussolier) und Stephan (Danile Auteuil)
beäugt das Paar mißtrauisch. Maxime und Stéphane sind Kompagnons
eines Geschäfts für Streichinstrumente: Maxime verkauft, Stephan
stellt her. Er ist ein Künstler wie Camille: eben das ist die Tragik
der beiden. Die Kunst ist dem schweigsamen, in sich gekehrten Stephan:
„ein Traum”; die Virtuosin jedoch will die Erotik der
Musik in ihr wirkliches Leben holen. Die Hitze ihres Herzens – um
beim Titel zu bleiben – trifft auf das „Herz im Winter”,
zu dem Stephans Passion geworden ist. Wie er mit seinen Violinen
umgeht, so könnte er nie mehr eine Frau „erkennen”. Seine
Zärtlichkeit ist fetischisiert, gilt dem Holz, dem zart geschwungenen
„Ding”, dem Camille mit erotischer Leidenschaft in Ravels
vibrierend-aggressivem Trio ungeahnte Töne entlockt. Sautets „Herz
im Winter” wird mit Präzision und Kühle – um nicht zu sagen:
klassizistischer Kälte – als ein Ritual der Blicke erzählt. Blau
dominiert nicht nur die Hemden und Anzüge der beiden Männer: es
ist die Stimmungsfarbe dieser verfehlten Liebe, Augenblicke menschlicher
Wahrheit über nicht gelebte Leben, welche die Kunst aussaugte,
gespiegelt in einer polierten Welt mit preziös eingefaßten, abwesenden
Haltungen.
Der große alte Mann des afrikanischen Films, der Senegalese
Ousmane Sembene, verbirgt hinter dem Titel seines jüngsten Films
„Guelwaar” eine Parabel auf das Ende des unkorrumpierten
Afrikaners, der von den herrschenden „Modernen” umgebracht
und gleich zweimal von den Christen und den Moslems beerdigt wird.
Freilich ist der Regisseur, mit dem der Aufbruch Afrikas in die
Kinogeschichte begann, mit seinen ästhetischen Mitteln bei seinem
Anfang stehen geblieben. Die Botschaft hört man wohl, allein es
fehlt der Glaube an deren ästhetische Triftigkeit.
Der Rumäne
Dan Pita realisierte in Ceausescus „Neuschwanstein”, seinem
monstroesen Bukarester „Haus des Volkes”, der nicht fertiggestellt
wurde, die Parabel auf die Macht des Potentaten und die Revolte
gegen ihn. Immer wieder läßt Pita einen Aufzug an wechselnden
Szenen des Terrors, des Wahns und des Sadismus vorüberziehen, um
die Parabel vom „Luxushotel” (und seinem unterirdischen
Terror) zu visualisieren. Grand- Guignol auf rumänische Art, ein
spektakulärer Alptraum mit längst verbrauchten künstlerischen
Mitteln: halliges Gespenstertreiben in einer gigantischen Ruine.
von Wolfram Schütte
|
|